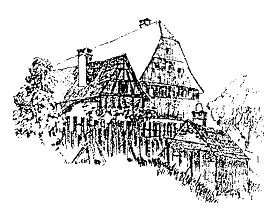Überlegungen zu Memoria und Propaganda am Beispiel romanischer Fassadenreliefs
Von Ulrike Kalbaum
Im Klostermuseum von Hirsau befindet sich ein rechteckiges, skulptiertes Fragment mit einer fast lebensgroßen Figur in Hochrelief, die mit angewinkelten Knien, gebeugtem Rücken und zum Gebet erhobener Hand von ihrer linken Seite zu sehen ist. Ihr leicht erhobener Kopf wird von einer Haartracht aus parallel liegenden Wülsten bedeckt, die über den nicht mehr vorhandenen Ohren enden. Ausgestochene Pupillen in kreisrunden Augen, eine kräftige Nase und eine Kerbe als Mund geben dem länglichen, spitz zulaufenden Gesicht ein starres Aussehen. Eine Tonsur und ein Bart sind nicht zu erkennen. Das unverzierte, bodenlange Gewand, das die Gestalt trägt, weist weder eine Kapuze auf, noch wird es von einem Gürtel gehalten. Während es am Arm eng anliegt, lässt es den Rumpf wie aufgeblasen wirken und legt sich nur auf der Rückseite unterhalb der Knie in vier wulstige Falten. Die Konturen des Körpers wirken dort, wo sie überhaupt zu erkennen sind, anatomisch unbeholfen: Der Hals ist überlängt, und der Oberarm scheint zu fehlen, da der Unterarm direkt in Höhe der Schulter ansetzt.
 |
| Hirsau Klostermuseum: der „betende Mönch“ (Bild: Autorin) |
Eine vorspringende Rahmenkante zu den – nicht erhaltenen – Füßen des Betenden dient als Standplatte und verbreitert sich zur rechten Seite. Bemerkenswert sind die über den Quaderrand hinausragenden Fingerspitzen der erhobenen Hand. Wegen seines Habitus und seiner erhobenen Hand wird der Dargestellte als „betender Mönch“ bezeichnet.
Der Stein ist circa 130 cm hoch, 65 cm breit und 42 (mit dem Relief der Figur 53) cm tief. Neben der bestehenden großen Ausbruchstelle am rückwärtigen Saum des Gewandes wies er bei seiner Auffindung zahlreiche kleinere Ausbrüche und Abstoßungen auf, die teilweise ergänzt und übermalt wurden. Im Gegensatz zu den unebenen Seitenflächen und der unregelmäßig ausladenden, unbearbeiteten Rückseite wirkt seine auffallend glatte Oberseite, die von den Fingerspitzen überragt wird, wie gesägt.
19281 wurde der Block am ehemaligen Südwestturm der Peter und Pauls-Kirche des Klosters Hirsau zusammen mit dem Fragment eines liegenden Löwen ausgegraben. Auf Grund des Fundorts und ihres Bearbeitungsstils, der Ähnlichkeiten mit den Gestalten des stehenden Nordturms erkennen lässt, wurden die Skulpturen dem im 18. Jahrhundert abgebrochenen Südturm zugeordnet und als Beweis für dessen Verzierung mit einem gleichwertigen Figurenfries, wie ihn der „Eulenturm“ aufweist, herangezogen. Nur im Hinblick auf die ursprüngliche Ausrichtung des Reliefs bzw. des Betenden finden sich unterschiedliche Auffassungen.
So ging Adolf Mettler, der den Stein bereits kurz nach der Auffindung in seinem 1928 erschienenen Kunstführer über Kloster Hirsau in einer Anmerkung beschrieben hat, von einer vertikalen Anbringung aus: „Kürzlich wurde am Fuße des Südturms ein Relief gefunden, das nach Größe und Form als ein Mittelstück aus dem entsprechenden Fries des zerstörten Turms anzusprechen ist. Es ist noch roher, ohne jedes organische Gefühl gearbeitet. Der Oberkörper der im Profil gegebenen Figur beugt sich zurück, die Hände greifen nach oben, der untere Teil des Körpers ist zurückgenommen, die ganze Gestalt wie unter einer Last eingeknickt. Die Haare und die Augen zeigen dieselbe Behandlungsweise wie am Eulenturm, aber Bart und Gürtung des Gewands fehlen.“2 Zur Tätigkeit und zur Identität des Dargestellten äußerte er sich nicht.
Karl Greiner, in dessen Garten die beiden Fragmente gefunden wurden, deutete 1929 in seiner Geschichte des Klosters Hirsau den Betenden als einen Novizen in weltlicher Kleidung, da ihm Ordenstracht, Bart und Tonsur fehlen.3 Seiner Meinung nach macht der Novize, der halbkniend die Hände wie betend nach oben strecken würde, eine spezielle Form der Verbeugung, die in den Constitutiones Hirsaugienses als „ante et retro“ bezeichnet wird. Er zog in Erwägung, dass am Südturm – in Analogie zum Nordturm mit den Laienbrüdern, die seiner damaligen Auffassung zufolge verschiedene Tätigkeiten ausführen – der Dienst der Mönche zu sehen war. Da er den Betenden als halbkniend und sich verbeugend umschrieb, ging er offenbar von seiner horizontalen Ausrichtung aus.
 |
| Hirsau, Klostermuseum: der „betende Mönch“ in horizontaler Ausrichtung (Bild: Autorin) |
In einer Schrift von 1934, in der Karl Greiner den Figurenfries am Nordturm astronomisch zu deuten versuchte, beschrieb er den Stein mit der „menschlichen Gestalt“ nur noch und verwarf in einer Anmerkung seine zuvor vermutete Deutung.4 Richard Strobel, der die romanische Bauplastik in der 1991 erschienenen Jubiläumsausgabe zur Hirsauer Klosterkirche bearbeitet hat, sah in der auf Fernsicht angelegten Skulptur – dem „sogenannten betenden Mönch“ – ein Gegenstück zu den Mittelfiguren am Nordturm, da er die vorspringende Kante zu ihren Füßen als Standplatte deutete, die eine ursprünglich aufrechte Anbringung belegen würde. Gleichwohl räumte er ein, dass die Haltung der Gestalt an eine Proskynese Erkl. erinnern würde.5
Im Führer des Klostermuseums Hirsau aus dem Jahre 1998 wurde der Betende von Brigitte Herrbach-Schmidt und Claudia Westermann als Mönch bezeichnet und die Vermutung geäußert, dass auch er Teil eines Figurenfrieses am Südturm war.6 Auf die Diskrepanz zwischen der gebräuchlich gewordenen Bezeichnung „betender Mönch“ und der Kleidung der Gestalt, die wesentliche Merkmale eines Mönchsgewandes vermissen lasse, wies Richard Strobel in seinem Katalogbeitrag zur Canossa-Ausstellung 2006 hin.7 Wegen stilistischer Ähnlichkeiten der Skulptur mit den bärtigen Mittelfiguren des Nordturm-Frieses zog er eine entsprechende Stelle am abgetragenen Südturm als Anbringungsort in Erwägung. Darüber hinaus setzte Strobel erstmals die einfach gearbeitete, betende Gestalt in Beziehung zum Auftraggeber, dem Reformkloster Hirsau, das sich maßgeblich dem Gebet und dem Totengedächtnis gewidmet habe.
In meiner 2011 erschienenen Dissertation über Tympana Erkl. in Südwestdeutschland habe ich die Körperhaltung der knienden und betenden Gestalt als Proskynese interpretiert, die nicht ohne einen Bezugsgegenstand aufwärts ins Leere, sondern vor einer anbetungswürdigen Person ausgeführt worden sein muss.8 Folglich habe ich vermutet, dass der Betende ursprünglich waagerecht angeordnet war. Da prosternierende Erkl. Gestalten in der romanischen Bauplastik vorwiegend an Tympana verbreitet waren und das ehemalige Westportal der Peter und Pauls-Kirche eine entsprechende Größe aufwies, habe ich in Erwägung gezogen, dass der Stein ein Teil des ehemaligen Tympanons vom Westportal war und die vermeintliche Standplatte somit ein Rest der Bogenfeldrahmung. Den Dargestellten habe ich auf Grund seiner Kleidung als Laien gedeutet, bei dem es sich in Analogie zu anderen Kniefiguren um einen Stifter oder den ausführenden Künstler gehandelt haben könnte.
Da die 1091 geweihte Peter und Pauls-Kirche einschließlich ihrer Vorhalle und des Südturms nicht mehr steht, lässt sich wohl nie mehr eindeutig klären, woher diese Skulptur ursprünglich stammt. Dennoch erscheint es lohnend, anhand von Vergleichsbeispielen aus der romanischen Bauskulptur zu überlegen, wo der Betende angebracht gewesen sein könnte, in welchen Kontext er gehört haben kann, wer der Dargestellte und wer der Auftraggeber war und welche Absichten mit ihm möglicherweise verfolgt wurden.